LONDON (IT BOLTWISE) – Eine neue Studie zeigt, dass Emotionen bei Wählern eine größere Rolle spielen als rationale Überlegungen. Die Analyse von fünf US-Präsidentschaftswahlen ergab, dass emotionale Reaktionen die Wahlentscheidung stärker beeinflussen als die Übereinstimmung mit politischen Positionen.
Eine aktuelle Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Frontiers in Political Science, legt nahe, dass Emotionen einen stärkeren Einfluss auf die Wahlentscheidungen der Wähler haben als die politischen Präferenzen. Die Forscher analysierten Daten von fünf US-Präsidentschaftswahlen zwischen 2000 und 2016 und stellten fest, dass Wähler nicht nur von der Übereinstimmung der Ansichten eines Kandidaten mit ihren eigenen beeinflusst werden, sondern auch davon, wie der Kandidat sie emotional anspricht. Positive emotionale Reaktionen auf einen Kandidaten haben einen größeren Einfluss auf die Wahlentscheidung als rationale Bewertungen auf Grundlage von Ideologie.
Traditionell wird das Wählen als rationaler Akt betrachtet, bei dem Bürger die Vor- und Nachteile der Kandidaten auf Basis von Themen, Politik und Kompetenz abwägen. Diese Perspektive wird durch langjährige Theorien wie die Rational-Choice-Theorie geprägt, die vorschlägt, dass Wähler kalkulierte Entscheidungen treffen, um ihren eigenen Nutzen zu maximieren. In diesem Modell vergleichen Individuen Parteiprogramme mit ihren eigenen politischen Präferenzen und wählen die Option, die den größten Vorteil verspricht.
Jedoch sind Emotionen seit langem Teil der politischen Erfahrung. Wahlkampagnen nutzen Musik, Bilder, Slogans und persönliche Geschichten, um sich emotional mit den Wählern zu verbinden. Politikwissenschaftler erkennen zunehmend an, dass Affekte (Gefühle wie Hoffnung, Stolz, Wut oder Angst) eine Rolle bei der Gestaltung des politischen Verhaltens spielen. Während gezeigt wurde, dass Emotionen Wähler mobilisieren und die parteiliche Identität stärken, haben nur wenige Studien direkt ihren Einfluss im Vergleich zu rationalem Denken bei der Bestimmung der Wahlentscheidung untersucht.
Die neue Studie zielte darauf ab, genau dies zu tun. Die Forscher wollten das Ausmaß bewerten, in dem emotionale Reaktionen und rationale Bewertungen unabhängig und gemeinsam die Wahlentscheidung vorhersagen. Wichtiger war jedoch, zu verstehen, ob emotionale Faktoren einen stärkeren Effekt haben als rationale.
Für ihre Studie analysierten Panagopoulos und Wang Wählerdaten aus den American National Election Studies, die Informationen aus national repräsentativen Umfragen rund um jede Präsidentschaftswahl sammeln. Sie konzentrierten sich auf die fünf Wahlen von 2000 bis 2016, die von George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump gewonnen wurden.
Die Forscher entwickelten ein statistisches Modell, das zwei Hauptkomponenten umfasste. Die erste war ein „Parteidifferential“, ein Maß dafür, wie ideologisch nah sich ein Wähler jeder großen politischen Partei fühlte. Dies repräsentierte die rationale Seite der Wahlentscheidung. Die zweite war das „Emotionsdifferential“, das widerspiegelte, wie positiv oder negativ ein Wähler die beiden großen Parteikandidaten empfand. Dies diente als emotionale Seite der Gleichung.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sowohl rationale Bewertungen als auch emotionale Reaktionen unabhängig voneinander beeinflussen, wie Menschen wählen. In jeder untersuchten Wahl waren Wähler, die sich ideologisch näher an einer Partei fühlten, eher geneigt, für diesen Kandidaten zu stimmen. Gleichzeitig waren diejenigen, die positivere Emotionen gegenüber einem Kandidaten empfanden – wie Hoffnung, Stolz oder Zuneigung – ebenfalls eher bereit, für ihn zu stimmen.
Die Forscher fanden jedoch heraus, dass emotionale Reaktionen typischerweise stärkere Prädiktoren als rationale Bewertungen waren. In der kombinierten Analyse über alle fünf Wahlen führte eine Erhöhung der emotionalen Präferenz um eine Standardabweichung zu einem Anstieg der Wahrscheinlichkeit, für einen Kandidaten zu stimmen, um 9,2 %. Im Gegensatz dazu führte eine ähnliche Erhöhung der politischen Übereinstimmung nur zu einem Anstieg von 3,1 %. Der emotionale Effekt war fast dreimal so groß.
Die Studie zeigt, dass Emotionen ausreichend Gewicht haben, um das Wahlverhalten über die gesamte Wählerschaft hinweg zu beeinflussen, was impliziert, dass Kampagnen, die emotionale Verbindungen aufbauen, überzeugender sein könnten als solche, die sich ausschließlich auf politische Argumente stützen. Gleichzeitig sollten Wähler sich bewusst bemühen, ihre eigenen Reaktionen zu reflektieren. Indem sie erkennen, wann ihre Emotionen ausgelöst werden, und dann bewerten, ob diese Gefühle durch die Bilanz oder die politischen Positionen eines Kandidaten gestützt werden, können Wähler den emotionalen Einfluss besser mit rationalem Urteil ausbalancieren.
Dieses Muster hielt in jedem untersuchten Wahljahr an. Beispielsweise hatte im Wahlkampf 2016 zwischen Donald Trump und Hillary Clinton das emotionale Differential den größten Einfluss von allen. Die Studie ergab, dass diejenigen, die positivere Emotionen gegenüber Trump empfanden, signifikant eher bereit waren, für ihn zu stimmen, unabhängig davon, ob sie mit seinen politischen Positionen übereinstimmten.
Die Daten deuten auch darauf hin, dass Emotionen in Wahlen ohne Amtsinhaber mehr zählen. In offenen Wahlkämpfen – wenn kein amtierender Präsident kandidiert – schienen die Wähler noch emotionaler getrieben zu sein. Emotionale Präferenzen hatten 2000, 2008 und 2016 einen stärkeren Einfluss als 2004 und 2012, als die Amtsinhaber George W. Bush und Barack Obama zur Wiederwahl antraten.
Ein weiterer Weg, wie die Forscher die Bedeutung von Emotionen bewerteten, war der Vergleich, wie gut verschiedene Modelle die Daten passten. Sie fanden heraus, dass Modelle, die sowohl rationale als auch emotionale Faktoren einbezogen, die Daten am besten passten. Modelle, die emotionale Überlegungen ausschlossen, schnitten schlechter ab. Dies legt nahe, dass das Ignorieren von Emotionen in Studien zum Wählerverhalten einen wesentlichen Teil des Bildes auslässt.
Schließlich testeten die Forscher, ob Rationalität und Emotion interagieren – ob emotionale Reaktionen die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen politische Positionen interpretieren, oder umgekehrt. Mit einer Ausnahme bei der Wahl 2016 zeigten die Daten wenig Unterstützung für diese Idee. Stattdessen schienen Emotion und Rationalität die Wahlentscheidung separat zu beeinflussen.
Obwohl sowohl rationales Denken als auch Emotionen die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen ihre Stimme abgeben, neigen Emotionen dazu, mehr Gewicht zu haben als rationale Überlegungen. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Wähler darauf achten sollten, ob ein Kandidat mehr auf ihre Gefühle als auf ihr Urteil abzielt und erkennen sollten, wie diese Emotionen ihre Entscheidungen beeinflussen.
Wenn man eine emotionale Reaktion erlebt, ist es ratsam, die Bilanz, die Politik oder die Debattenleistung des Kandidaten zu überprüfen, um zu sehen, ob die Gefühle auf Substanz beruhen. Wähler sollten auch vorsichtig gegenüber emotionalen Appellen bleiben, da Kampagnen oft Musik, Bilder und Geschichten verwenden, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, und das Bewusstsein für diese Taktiken kann zu ausgewogeneren Entscheidungen führen.
Die Studie liefert robuste Beweise über mehrere Wahlen hinweg, aber die Autoren erkennen an, dass es noch einige Einschränkungen gibt. Zum Beispiel konzentrierte sich ihre Analyse auf direkte Effekte und untersuchte nicht die vielen Wege, wie Emotionen auch indirekt die Wahlentscheidung beeinflussen könnten. Zum Beispiel können Emotionen beeinflussen, wie Menschen Informationen suchen, Nachrichten interpretieren oder Kampagnenbotschaften verarbeiten. Diese subtileren Dynamiken lagen außerhalb des Rahmens der aktuellen Studie.
Darüber hinaus basierten die verwendeten Maße für Rationalität und Emotion auf selbstberichteten Umfrageantworten, die möglicherweise nicht alle Dimensionen erfassen, wie Menschen politische Urteile bilden. Zukünftige Forschung könnte alternative Wege zur Messung sowohl kognitiver als auch emotionaler Inputs erkunden, einschließlich wie sie sich im Laufe der Zeit ändern oder auf spezifische Kampagnentaktiken reagieren.
Unsere nächsten Schritte bestehen darin, zu untersuchen, ob Rationalität und Emotion eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung des politischen Verhaltens von Individuen spielen, wie zum Beispiel der Teilnahme an Protesten, und ihre Auswirkungen in Kontexten außerhalb der Vereinigten Staaten zu untersuchen.

- Die besten Bücher rund um KI & Robotik!

- Die besten KI-News kostenlos per eMail erhalten!
- Zur Startseite von IT BOLTWISE® für aktuelle KI-News!
- IT BOLTWISE® kostenlos auf Patreon unterstützen!
- Aktuelle KI-Jobs auf StepStone finden und bewerben!
Stellenangebote

Product Owner/Manager for AI Solutions (m/f/d)

Werkstudent (m/w/d) Digitalisierung & KI bei Airports im Ingenieurwesen

Junior Produktmanager (m/w/d) Automatisierung & KI, InsurTech

Duales Studium – Data Science und Künstliche Intelligenz (m/w/x), Beginn Herbst 2026

- Künstliche Intelligenz: Dem Menschen überlegen – wie KI uns rettet und bedroht | Der Neurowissenschaftler, Psychiater und SPIEGEL-Bestsellerautor von »Digitale Demenz«
Du hast einen wertvollen Beitrag oder Kommentar zum Artikel "Emotionen beeinflussen Wähler stärker als Fakten" für unsere Leser?






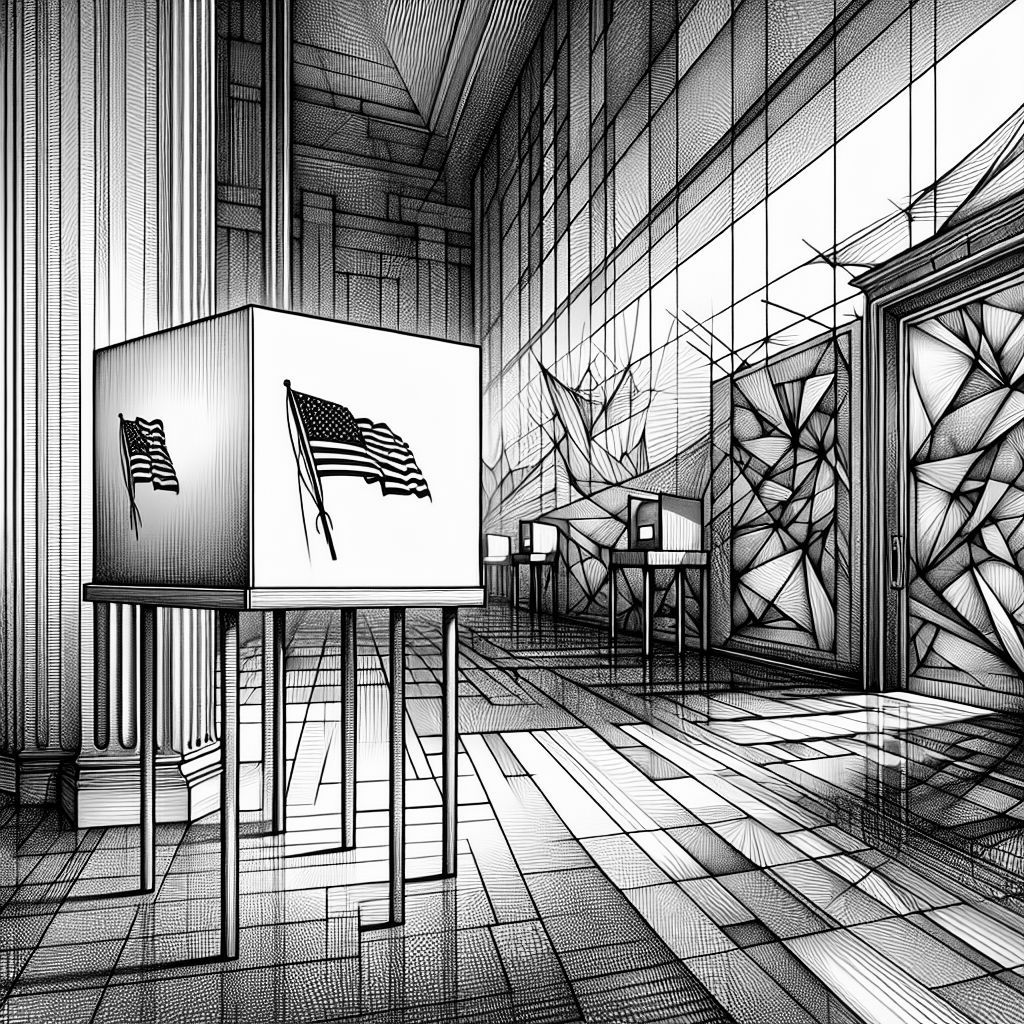








 #Sophos
#Sophos
Es werden alle Kommentare moderiert!
Für eine offene Diskussion behalten wir uns vor, jeden Kommentar zu löschen, der nicht direkt auf das Thema abzielt oder nur den Zweck hat, Leser oder Autoren herabzuwürdigen.
Wir möchten, dass respektvoll miteinander kommuniziert wird, so als ob die Diskussion mit real anwesenden Personen geführt wird. Dies machen wir für den Großteil unserer Leser, der sachlich und konstruktiv über ein Thema sprechen möchte.
Du willst nichts verpassen?
Du möchtest über ähnliche News und Beiträge wie "Emotionen beeinflussen Wähler stärker als Fakten" informiert werden? Neben der E-Mail-Benachrichtigung habt ihr auch die Möglichkeit, den Feed dieses Beitrags zu abonnieren. Wer natürlich alles lesen möchte, der sollte den RSS-Hauptfeed oder IT BOLTWISE® bei Google News wie auch bei Bing News abonnieren.
Nutze die Google-Suchmaschine für eine weitere Themenrecherche: »Emotionen beeinflussen Wähler stärker als Fakten« bei Google Deutschland suchen, bei Bing oder Google News!